Ein Jahr CETA

Collage aus Bildern von Africa Studio und daboost - Fotolia
(München, 21.9.2018) Vor einem Jahr trat das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen CETA vorläufig in Kraft. Im Alltag der meisten Menschen hat sich dadurch nichts geändert. Doch die Mechanismen des Abkommens wirken, und zwar genau so, wie es vorausgesagt wurde. Im Hintergrund nagt das Abkommen bereits jetzt an der Demokratie. Doch es gibt noch Gelegenheiten, es zu stoppen: Politisch im Bundestag und im Bundesrat oder vor den höchsten Gerichten in Karlsruhe und Luxemburg.
Die EU-Kommission, die den Vertrag verhandelt und politisch dafür geworben hat, erwartete davon nur marginale wirtschaftliche Effekte. Das Bruttoinlandsprodukt der EU sollte durch das Abkommen um 0,076 Prozent steigen. In ihren Veröffentlichungen zum Jahrestag spricht die Kommission trotzdem nur von wirtschaftlichen Chancen. Auf der Basis der Statistiken aus den ersten Monaten sagt sie ein Wachstum der Exporte um 7 Prozent im ersten Jahr voraus. Dabei schwankten die europäischen Exporte nach Kanada schon immer deutlich: Von 2014 auf 2015 stiegen sie um 3 Prozent, nur um im nächsten Jahr wieder um 4,6 Prozent zu fallen.
Die Handelspolitik der EU ist ausschließlich auf Wirtschaftswachstum und immer mehr internationalen Handel aus – koste es, was es wolle. Dabei kann es angesichts des Klimawandels nicht sinnvoll sein, immer mehr Fleisch, Käse, Möbel oder Obst über den Atlantik zu schiffen.
Und während sich die EU-Kommission über einen Anstieg der Obstexporte nach Kanada um fast 30 Prozent freut, wirken im Hintergrund Mechanismen, die für unsere Demokratie gefährlich sind. So trafen sich im März und April erstmals Gremien, in denen Kanada und die EU sich über Gentechnik und Lebensmittelsicherheit austauschen. Auf den Tagesordnungen standen politisch hoch umstrittene Themen. So ging es im März zum Beispiel darum, wie die Mitgliedstaaten der EU mit Glyphosat umgehen.
Diese Form der „regulatorischen Kooperation“ ist in CETA für sehr viele Politikfelder vorgesehen. Die Ausschüsse und Foren, die es dafür gibt, können teilweise sogar selbst Entscheidungen treffen. Dabei tagen sie hinter verschlossenen Türen und ohne die Beteiligung von gewählten Abgeordneten. Hier entsteht vor unseren Augen ein Paradies für die Lobby der Konzerne.
Die zweite große Gefahr für die Demokratie liegt im Kapitel 8 des Abkommens: Der Investitionsschutz, der international agierenden Konzernen Sonderrechte gibt, die vor Schiedsgerichten durchgesetzt werden können. Doch diese Regeln sind noch nicht in Kraft. Sie werden erst dann wirksam, wenn alle Mitgliedstaaten der EU das Abkommen ratifiziert haben.
Kanadische Unternehmen sind weltweit stark beim Abbau von Rohstoffen aktiv und setzen ihre Interessen dabei oft ohne Rücksicht auf Umwelt, AnwohnerInnen und Demokratie durch. So drohte ein kanadisches Unternehmen letztes Jahr dem französischen Staat mit einem Schiedsgericht und horrenden Schadensersatzforderungen. Hintergrund war ein Gesetzentwurf, der die Extraktion der fossilen Energieträger Öl und Gas in Frankreich verbieten sollte. Später wurde eine abgeschwächte Version des Gesetzes beschlossen. Es waren diese Erfahrungen, die den französischen Umweltminister Nicolas Hulot dazu bewegten, zurückzutreten.
Die Drohung des kanadischen Unternehmens war möglich, weil europäische Tochterfirmen den Vertrag über die Energiecharta nutzen können, um Frankreich vor ein Schiedsgericht zu zwingen. Das Beispiel ist nur eines von vielen. Es wäre ein großer Fehler, CETA zu ratifizieren und international tätigen Konzernen damit noch mehr Sonderrechte zu geben.
Während die ersten Effekte des Abkommens schon sichtbar sind, müssen noch mehrere Gerichte entscheiden, ob der Vertrag verfassungswidrig ist. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg überprüft auf Antrag der belgischen Regierung, ob der Investitionsschutz in CETA mit den EU-Verträgen vereinbar ist. Diese Frage war ein Zugeständnis an die Regierung der Region Wallonie, die im Herbst 2016 die Unterzeichnung des Abkommens blockierte.
Die erste Anhörung vor Gericht am 26. Juni verlief durchaus vielversprechend. Zwar argumentierte Slowenien als einziger Mitgliedstaat deutlich gegen den Investitionsschutz. Doch die RichterInnen zeigten mit vielen Nachfragen, dass sie das Problem verstanden haben. Die Entscheidung des EuGH, dass Investitionsschutz mit Schiedsgrichten innerhalb der EU gegen die Verträge verstoßen, ist ebenfalls ein gutes Zeichen. Allerdings kann man sie nicht direkt übertragen, denn das Urteil passt zur Tendenz des EuGH, die Institutionen der EU zu stärken und zu schützen – da CETA ein Vertrag der EU selbst ist, fällt das Argument in diesem Fall weg.
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt derweil eine Verfassungsklage von über 125.000 BundesbürgerInnen. Die Klage, die von unseren KollegInnen bei Campact, Mehr Demokratie e.V. und Foodwatch initiiert wurde, kann sich noch lange hinziehen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung in Luxemburg abwartet.
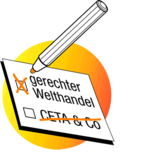
Grafik: Netzwerk gerechter Welthandel
Von den 27 Mitgliedstaaten, die CETA ratifizieren müssen, haben das erst neun formal vollständig getan. Darunter sind viele, in denen CETA kaum umstritten und die Bewegung dagegen schwach war, zum Beispiel die baltischen Staaten. Sehr ärgerlich ist, dass die rechtskonservative Koalition in Österreich angekündigt hat, dem Abkommen zuzustimmen. In Österreich ist die Ablehnung des Abkommens sehr stark. Im Januar 2017 unterschrieben in nur zwei Wochen 562.552 ÖsterreicherInnen ein Volksbegehren gegen die Abkommen TTIP, CETA und TiSA.
In Deutschland könnten der Bundestag und Bundesrat das Abkommen noch ablehnen. Hier ist die Bewegung gegen die Abkommen stark. Und Deutschland könnte einen Konflikt mit der EU-Kommission und vielen anderen Mitgliedstaaten realpolitisch aushalten – anders als z.B. das kritische, aber kleine Slowenien oder die linke Regierung in Griechenland.
Während im Bundestag die Große Koalition das Abkommen positiv sieht und mit der FDP mindestens eine Oppositionspartei ebenfalls für das Abkommen eintritt, haben im Bundesrat insgesamt elf Landesregierungen mit Grüner und Linker Beteiligung eine große Mehrheit. Hier besteht eine Chance, CETA zu verhindern. Dafür braucht es jedoch nach wie vor viel Druck aus der Zivilgesellschaft, denn es gibt große Bundesländer wie Hessen und Baden-Württemberg, in denen die Grünen umfallen könnten. Insbesondere in Hessen, wo im Herbst Landtagswahl ist, lohnt es sich daher, immer wieder bei den lokalen LandtagskandidatInnen nachzufragen, wie sie zu CETA stehen. Aber auch in Bayern lohnt es sich, die KandidatInnen der CETA-kritischen potentiellen Koalitionspartner der CSU, also SPD, Grüne und Freie Wähler, immer wieder öffentlich festzunageln.
Es ist wahrscheinlich, dass die Regierung die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts abwartet, bevor sie das Abkommen dem Bundestag vorliegt. Es kann also sein, dass die Abstimmungen im Bundestag und Bundesrat erst nach der Bundestagswahl 2021 und vielen weitere Landtagswahlen stattfindet. Wir müssen also aufmerksam bleiben. Für den 29. September ruft das Netzwerk Gerechter Welthandel zu einem Aktionstag gegen CETA auf. Eine gute Gelegenheit, der Öffentlichkeit und den PolitikerInnen vor Ort zu zeigen, dass CETA und seine Gefahren nicht vergessen sind. mehr zum Aktionstag finden Sie unter www.ceta-aktionstag.de.
Benachrichtigungen

